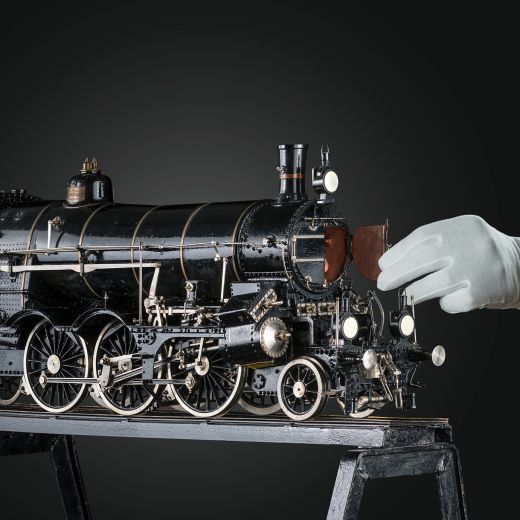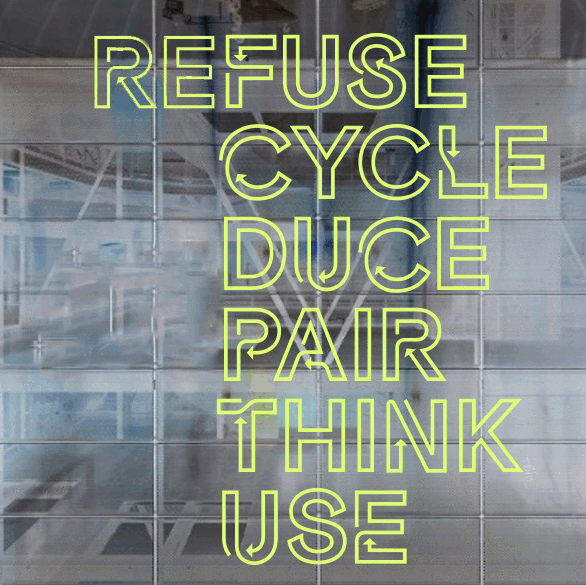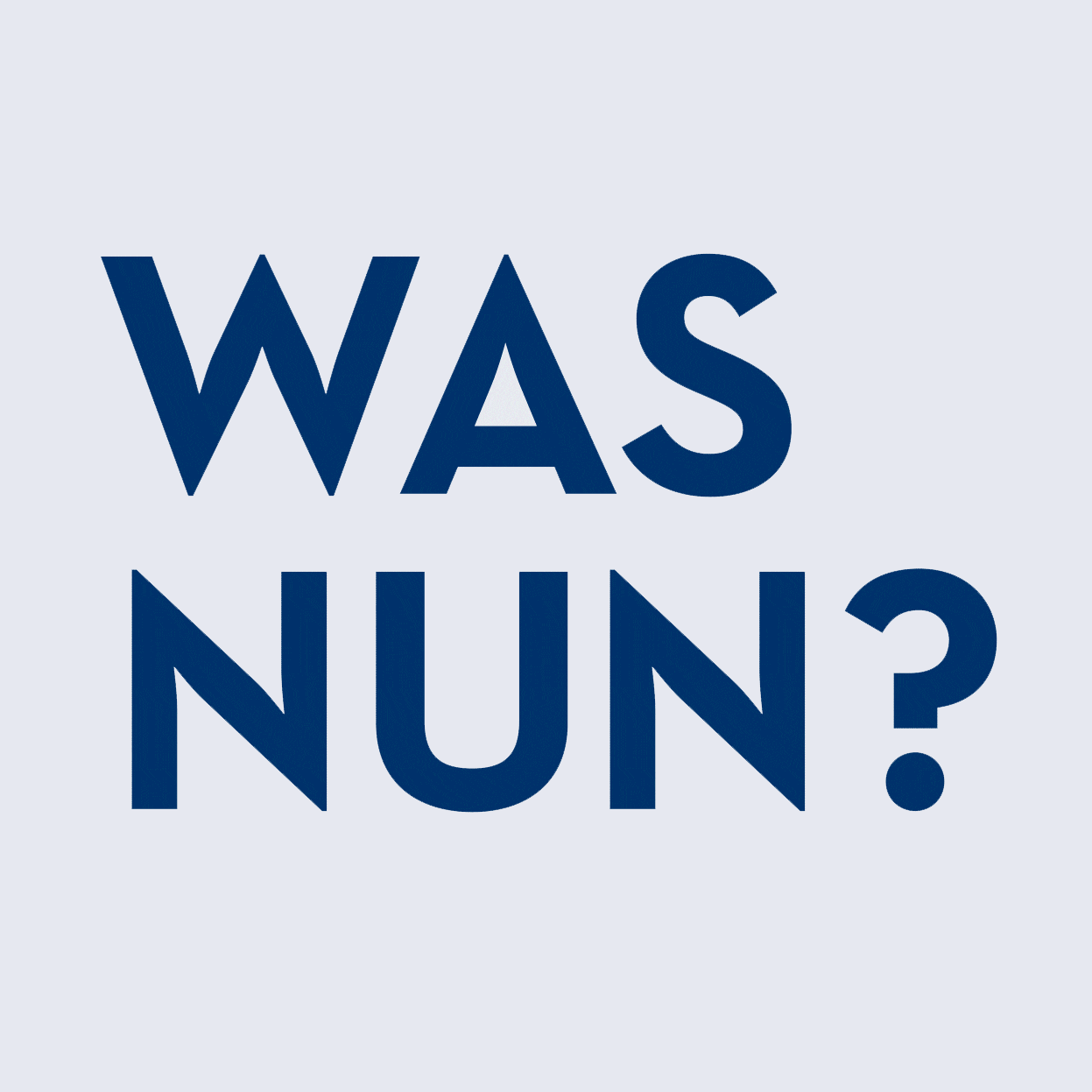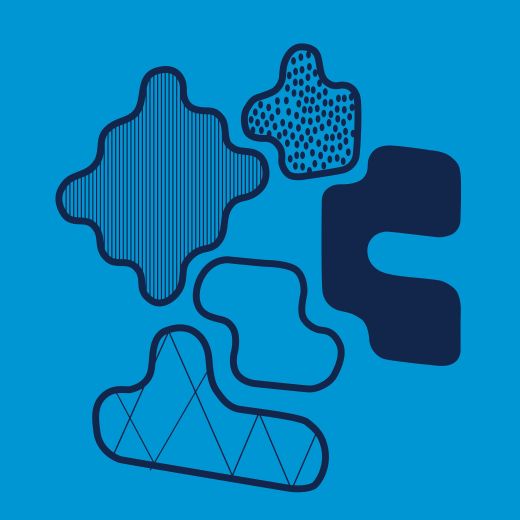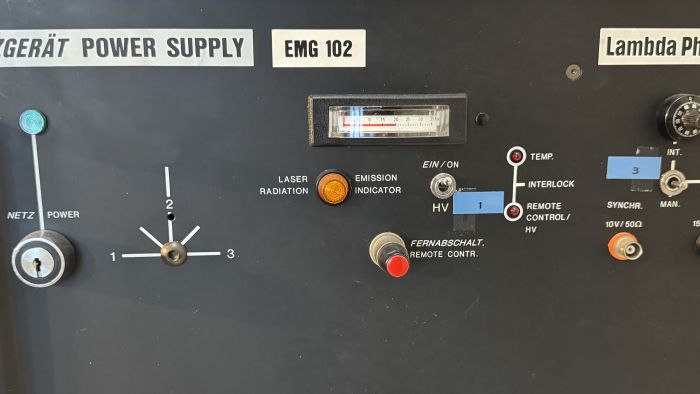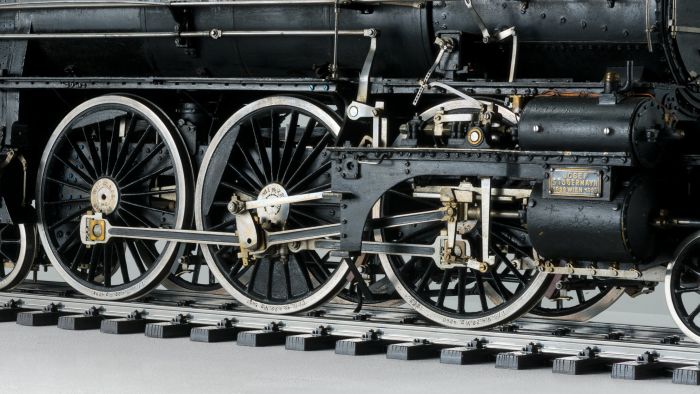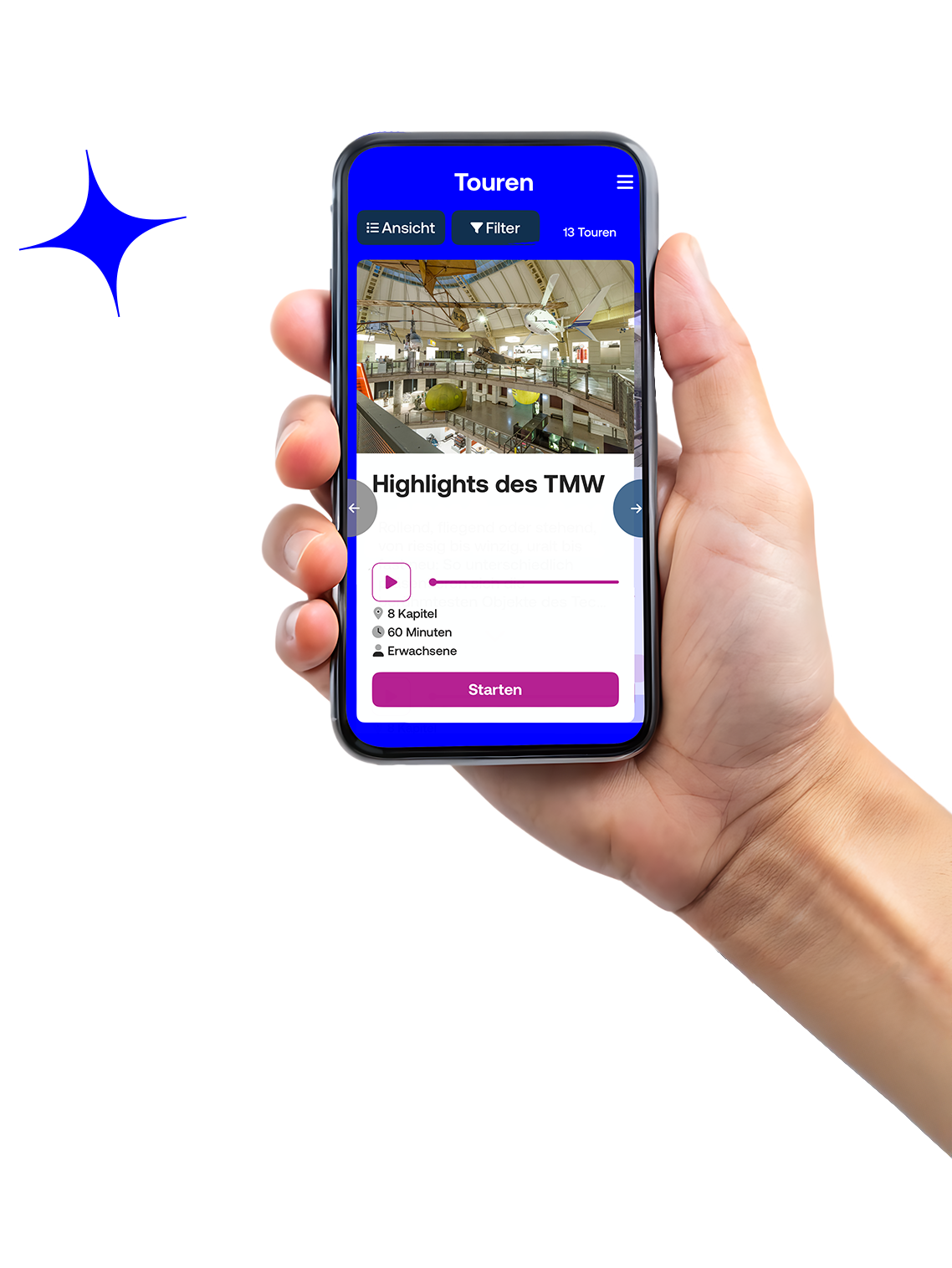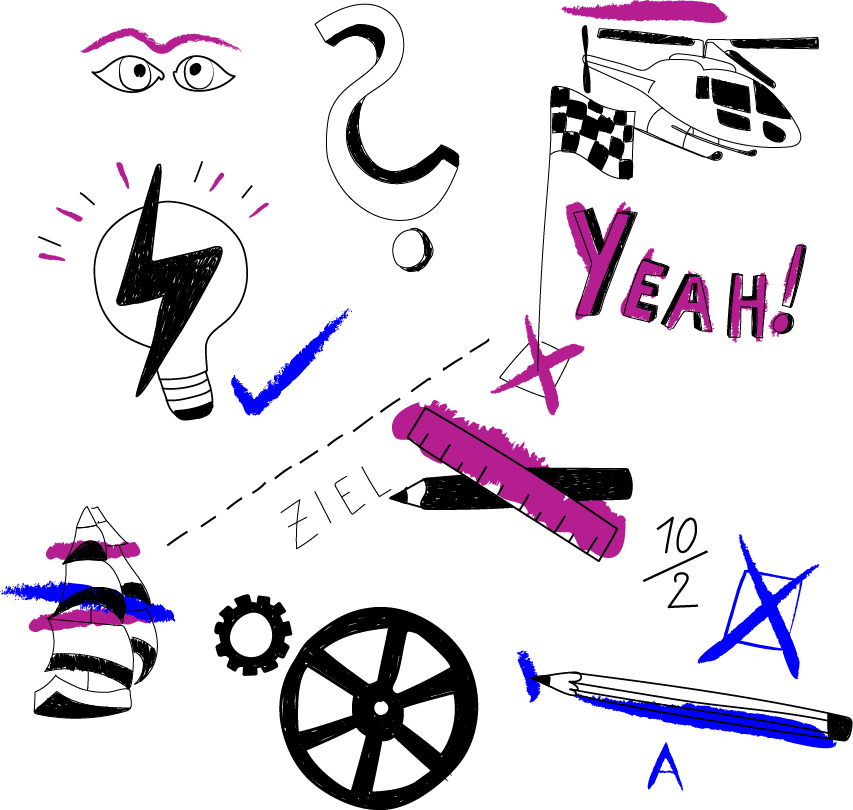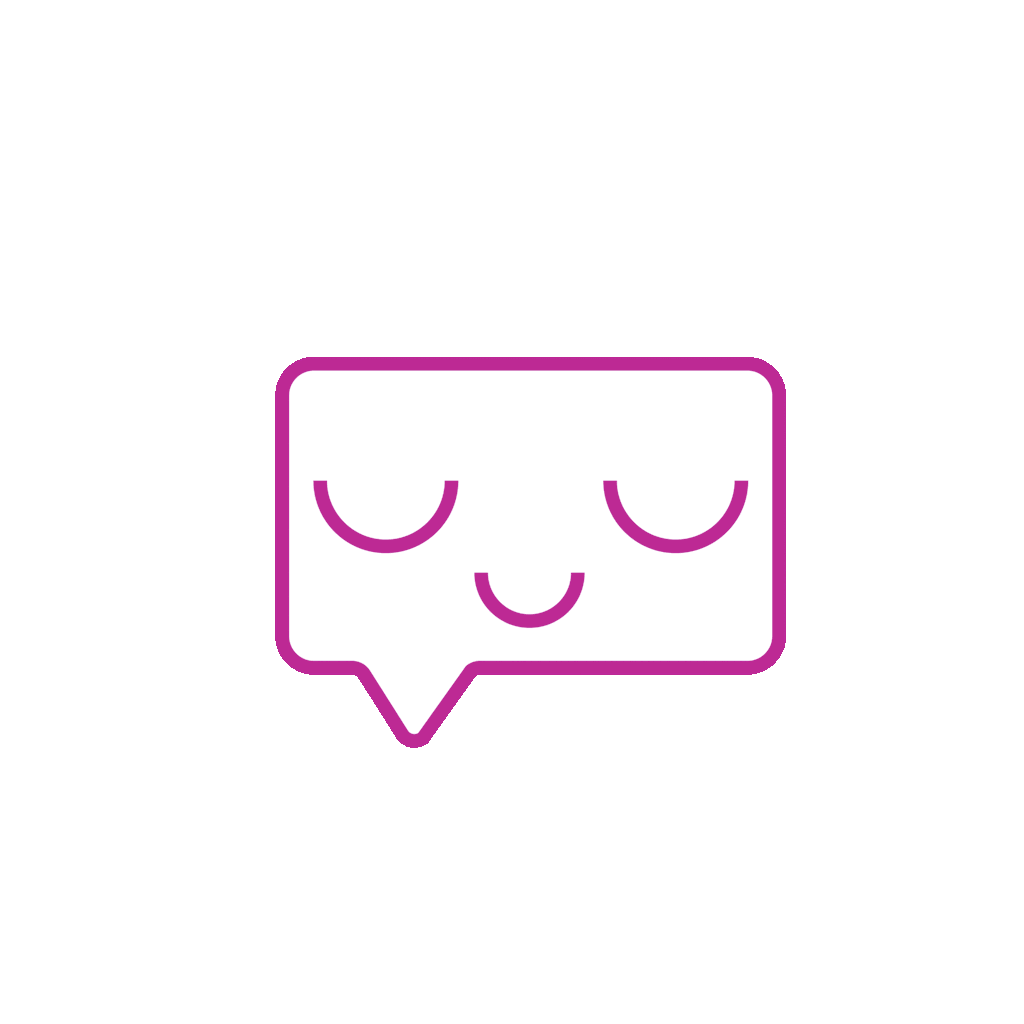Sei Neugierig - im Technischen Museum Wien
In unseren vielfältigen Ausstellungen treten historische Objekte in einen Dialog mit neuen Technologien. Spannende Vermittlungsprogramme erwecken unsere Exponate zum Leben und zahlreiche Hands-On-Experimente laden ebenso wie unsere Rätselrallyes zum Mitmachen und Ausprobieren ein. AHA-Momente garantiert!
PLANEN SIE IHREN BESUCH - WIR EMPFEHLEN FÜR
Ausstellungen
Heute im TMW
Für die Zielgruppe: Kinder & Familie
3-8 Jahre
Reservierung Kinderbereich
€ 2,50
Mo 05.01.14:00–14:40
Reservierung Kinderbereich
1 Platz frei
€ 2,50
Mo 05.01.16:00–16:40
Reservierung Kinderbereich
16 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.17:00–17:40
Reservierung Kinderbereich
40 Plätze frei
€ 2,50
Für die Zielgruppe: Kinder & Familie
1,5-5 Jahre
Reservierung Kinderbereich
€ 2,50
Mo 05.01.12:00–12:40
Reservierung Kinderbereich
21 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.13:00–13:40
Reservierung Kinderbereich
18 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.14:00–14:40
Reservierung Kinderbereich
24 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.15:00–15:40
Reservierung Kinderbereich
14 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.16:00–16:40
Reservierung Kinderbereich
31 Plätze frei
€ 2,50
Mo 05.01.17:00–17:40
Reservierung Kinderbereich
26 Plätze frei
€ 2,50
Für die Zielgruppe: Für alle
Ab 10 Jahren
Führung / Aktion
€ 3,90
Mo 05.01.13:30–14:00
Führung / Aktion
4 Plätze frei
€ 3,90
Mo 05.01.15:30–16:00
Führung / Aktion
4 Plätze frei
€ 3,90
Mo 05.01.17:00–17:30
Führung / Aktion
2 Plätze frei
€ 3,90
11:00–11:30
Für die Zielgruppe: Für alle
Ab 7 Jahren
Führung / Aktion
34 Plätze frei
€ 5,50
11:00–12:00
Für die Zielgruppe: Kinder & Familie
4-7 Jahre
Workshop
1 Platz frei
€ 6,50